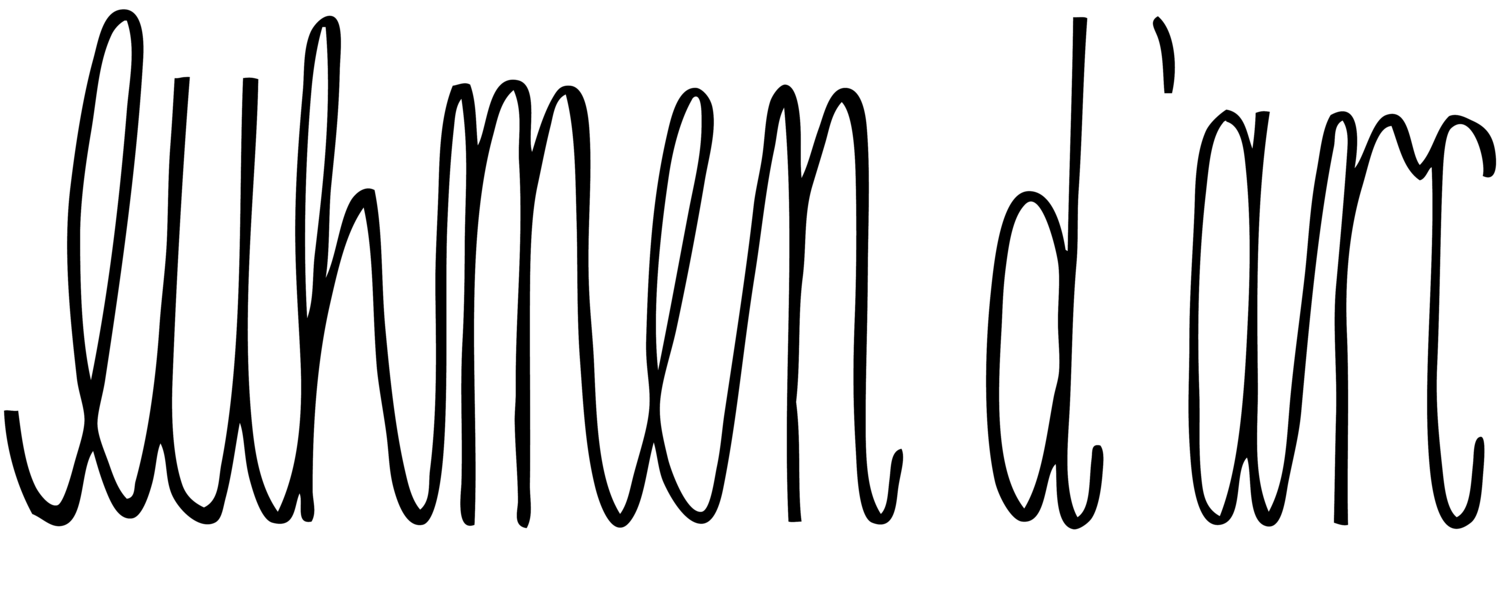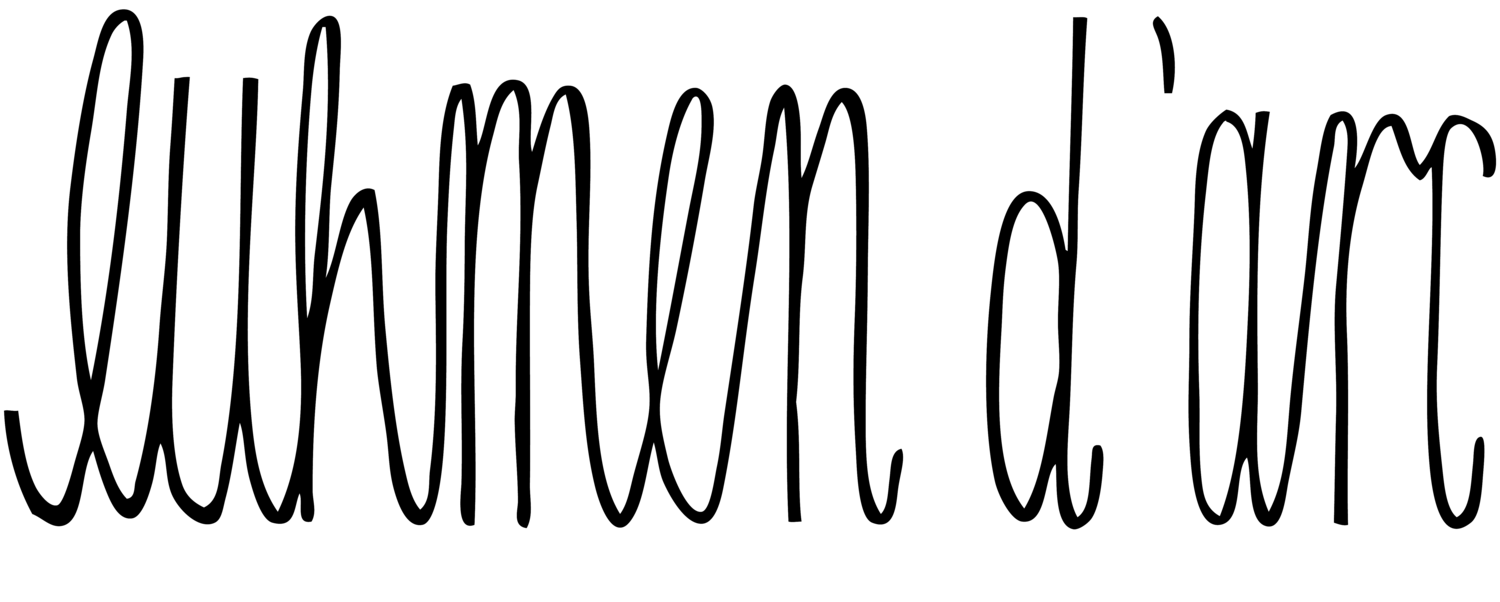Von Wellness und Exorzismus. Ein Versuch über die Frage, was eine Session wertvoll macht
Immer wieder eine Gratwanderung: die Sache mit den Sitzkreisen in Workshopsettings. Unerträglich pädagogisch, wenn Reihum jede•r wie die Hühner auf der Stange ein Ei legen und etwas sagen muss (Fußnote: und wie interessanterweise erstaunlich oft dann über die eigene Müdigkeit oder Wachheit Auskunft gegeben wird). Andererseits ist es aber auch so herrlich demokratisch, wenn jede•r•m Raum zum Sprechen und Hören gegeben wird, ohne dass Schüchternheit oder Selbst(über)sicherheit darüber entscheiden, wer spricht. Und dann ist da die zugegebenermaßen immer auch kraftvolle Kreissymbolik, die in Séancen sogar Tische wie von Geisterhand rücken lässt… Und ähnlich wie bei diesen spiritistischen Zirkeln scheint sich auch in Workshop-Gesprächskreisen das meiste Potential durch präzise Fragen heraufbeschwören lassen.
Während unseres letzten Fesselmassageworkshops in Karlsruhe vor einigen Wochen stellte sich eine solche Frage aus der Not heraus – und war für mich selber wahnsinnig aufregend. Die in der Diskussion beschworenen Geister suchen mich zumindest weiterhin heim.
Kurz zum Hintergrund: Der Kurs fragt, wie der achtsame und kunstvolle Einsatz von Seilen Massagerituale anreichern kann und bietet ein Repertoire an Techniken, Hinweisen, Inspiration und Vorschlägen, um raffinierte und sinnliche Interaktionen, bzw. Sessions zu kreieren. Der Workshop ging über drei Tage, den zweiten und dritten Abend schlossen wir mit eineinhalbstündigen Sessions ab, in welchen die Teilnehmer•innen das bisher Gelernte und Mitgebrachte im freien Spiel mit einer empfangenden Person ausprobieren konnten. Das Reizvolle und Herausfordernde dieser Szenen liegt in ihrer Stegreiferfindung. Im Gegensatz zu den angeleiteten Übungen wird man hier nicht mehr an die Hand genommen, sondern lässt sich auf das spontane, unvorhersehbare Hier und Jetzt ein, auf sich selber und den anderen. Vielleicht geht man mit bestimmten Ideen und Vorhaben rein, muss sich aber auf die unwillkürlichen Impulse der gemeinsamen Improvisation einlassen. Dann kann Magie entstehen – oder man geht verloren. Woran sich dann festhalten? Die schematischen Praktiken, Muster und Anleitungen? Einfach möglichst viele Sensationen reingeben, damit die empfangende Person sich nicht langweilt – oder damit man so die eigene Unsicherheit kaschiert? Auf das bisher Wohlbewährte zurückgreifen? Vor allem wenn man mit jemandem interagiert, den•die man schon lange kennt, bieten sich Verhaltensroutinen an, die Sicherheit geben. Worum geht es dann aber in einer Session? Warum machen wir das eigentlich? Am Ende soll es ja nicht bloß darum gehen, die 90 Minuten ganz gut rumzubekommen – sozusagen hauptsache unfallfrei und höhepunktreich. Und irgendwie macht man es doch auch, um am Ende mehr oder anderes zu erleben, als wie man es sich sonst beim Netflix-&-Chillen-Fummeln gut gehen lässt.
Am dritten Tag haben wir nach einer kleinen Aufwärmübung den Tag also mit eben dieser Frage begonnen: Was macht für Euch als empfangende Person eine gute Session aus? Was ist Euch dabei wichtig? Wonach sucht Ihr, wenn Ihr Euch eine Session wünscht (oder gar bucht)? Mit dem darauf folgenden diskutierten Input erschlossen sich die Szenerien der Rückrunden als wesentlich runder und substanzieller.
Neben der Betonung von Ehrlichkeit (was man mit dieser einzigartigen Person in diesem einzigartigen Moment wirklich will und was nicht), der Verständigung auf Codes zum Abbruch und Verändern der Szene und dem Vertrauen darauf, dass das Gegenüber einem deutlich mitteilt, wenn etwas nicht mehr stimmt, war für mich besonders anregend der Hinweis darauf, dass es in Sessions nicht um Wellness geht. Behagliche Entspannung kann ein Aspekt sein. Das neugierige und mutige Ausloten eigener Grenzen oder die Konfrontation mit dem, was gerade ansteht, sich ausprobieren möchte oder ein Ventil braucht, lädt jedoch zu der Einsicht ein, dass man sich während der Session nicht immer klassisch happy fühlen muss. Weil man, jetzt mal groß formuliert, etwas Existentielles über das Menschsein erfahren möchte. So können sich beispielsweise Momente der (im funktionierenden Alltag meist nur negativ konnotierten) Scham als Prozesse darstellen, in denen sich ein in Nacktheit und Hingabe befindendes Individuum in intimer Selbsterkenntnis selbst gegenübertritt, sich so selber fremd wird und sich doch auf tieferer Ebene zurückgewinnt. Wenn Sessions ekstatische Zustände hervorrufen, dann erzeugt dieser Rausch bestimmte Formen von Hellsichtigkeit, die dem Subjekt Zugänge zu Bereichen bieten, die sonst verschlossen sind – und die gastfreundschaftlich willkommen geheißenen, auftauchenden Emotionen (wie Scham oder Wut, für die es sonst kaum adäquate Orte zum Ausleben gibt, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen) können ein Zugang zu diesen Bereichen sein. Das ist nicht immer einfach und risikofrei, kann aber bereichernd und vor allem außergewöhnlich lustvoll sein.
Die auf die Ausgangsfrage geteilten Überlegungen machten darüber hinaus deutlich, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. Ja, es fühlt sich schön an, wenn man über meine Kniekehle streichelt, meine verspannte Schulter knetet und ein Seil um mein Handgelenk schlingt. Aber das ist es dann doch nicht, wenn mal hier ein bisschen gestreichelt wird und dann da ein bisschen gefesselt. Die Begriffe „Komposition“ und „Dramaturgie“ fielen – es geht also um strukturierte Abläufe. Gewissermaßen erzählen wir während einer Session also eine Geschichte, die Anfang und Ende und einen Spannungsbogen dazwischen hat. Wie ein Ereignis zum nächsten führt ist nicht willkürlich, sondern verfolgt einen bestimmten Sinn – auch wenn dieser unterhalb der Ratio und in nicht-linearen, labyrinthischen Sphären verlaufen kann.
In Schreibtrainings wird angeleitet, wie Spannungskurven als rote Fäden und Klammern, die die Geschichte zusammenhalten, entwickelt werden können, um bei den Leser•innen Aufmerksamkeit, Erwartung und Interesse über mehrere Seiten aufrechtzuerhalten. Wie ein langsam zu schürendes Feuer wird da die Dramatik langsam gesteigert und sich darum bemüht, Unvorhersehbarkeit des weiteren Verlaufs zu wahren, der im Rückblick plausibel und folgerichtig bleibt. Suspense entsteht durch Feingefühl für das Herauszögern von Lösungen, dem Einbauen von Überraschungen, die sich aus der Eigenlogik der Narration ergeben – also nicht bloß arbiträr eingestreut werden. Solches Storytellinglässt sich wunderbar auf Bodywork-Session übertragen. Damit jedoch die schmale Linie zwischen ‚nicht-beliebig‘ und trotzdem ‚absichtslos‘ eingehalten wird, damit der empfangenden Person nicht stur zielgerichtet etwas aufgezwungen wird, was nichts mit ihr und ihren Bedürfnissen zu tun hat, ist ein notwendiges Stichwort ‚Präsenz‘, die sich die meisten Teilnehmer•innen für ihre Sessions vom anderen wünschten. Auf jeden Fall merke ich als empfangende Person, ob mir jetzt nur ein Klaps auf den Hintern gegeben wird, nicht weil es sich aus der Situation ergibt, sondern weil mein Gegenüber meint, dass das halt irgendwas mit Kinkyness zu tun hat oder er•sie bloß ein ganz bestimmtes Bild erfüllen möchte, statt bei uns zu bleiben.
Präsenz lässt mich spüren: da ist jemand bei mir und hat wirklich ein Interesse an mir, an meiner Lust, möchte etwas herauskitzeln, ist explorativ und investigativ unterwegs. Als ich in der Sitzkissenrunde an der Reihe war zu berichten, was für mich eine gelungene Session ausmacht, fiel mir dazu der etwas drastische Begriff des Exorzismus ein, der nicht für alle so verheißungsvoll aufgeladen sein mag wie für mich, jedoch bestimmten Aspekten gerecht wird, die ich von tollen Sessions kenne: ein ritueller Einschlag, der mich in einen Zustand gesteigerter Berührbarkeit führt, mit dem Ziel, dass etwas (archäologisch?) aus mir ausgehoben wird, was in mir schlummert und sich im Alltag vielleicht nicht raustraut (oder nicht raustrauen darf). Dass die gebende Person dafür auch mal was wagen muss. Dass ich mich dabei auch vor dem, was in mir ist, erschrecken kann oder zumindest davon auch überrascht sein oder einfach schamlos genießen darf, welche Kräfte im Körper sind. Etwas Unsichtbares will sichtbar gemacht werden. Will sich zeigen. Und die Session hält einen sicheren Raum, in welchem ich das mal darf und dabei begleitet werde. Wo das nicht too much ist, nicht weggetröstet, nicht verwertet und nicht therapeutisch gedeutet oder weggeheilt werden muss.
Gesehen zu werden und zu merken, die andere Person hat einfach ganz urteilsfrei und wohlwollend (selbst wenn es zwiebelt!) Freude daran, diesen sonst verborgenen Teil von mir zu sehen und zu erkennen, macht die Situation auch schlichtweg geil. Weil sie radikal Nähe und Intimität schafft. Und weil sie unendliche Resonanzspiralen erzeugt: mich macht es geil, dass du es geil findest mich zu sehen; meine dadurch ausgelöste gesteigerte Geilheit macht wiederum dich geiler, was wieder in mir etwas auslöst was wieder etwas Intensives in dir auslöst,…
Das scheint jedoch erst möglich, wenn man im Verlauf der Session auch ruhig mal bei einer Sache bleibt, die sich als Schlüssel für interessante Reaktionen und weitere tiefere Explorationen erweist – was wiederum dafür spricht, als gebender Part nicht zwanghaft an seinem eigenen Plan und seinen noch nach Verwirklichung strebenden Ideen zu hängen. ‚Viel‘ ist nicht immer ‚Mehr‘ und es ist nichts damit gewonnen, gleich sein ganzes Pulver verschießen (obwohl der bewusst eingesetzte Overkill auch mal einen Versuch wert wäre). Selbst wenn es dann Hängepunkte gibt und man doch gerade mit seinen neuen Suspensionskills glänzen wollte, lenkt man damit wohlmöglich nur von etwas Spannenden ab, das sich im Floorwork beim Berühren des im Futomomo eingeschnürten Beines doch gerade am Enfalten war. Warum dann nicht dort noch etwas verweilen? Statt dann alle möglichen Fesselungen anzulegen, ist vielleicht mehr und virtuoseres erreicht, einfach noch eine Lage Seile um eben dieses bereits verschnürte Bein zu wickeln. Und noch eine, und noch eine…
Damit kamen wir auf den nächsten nicht zu unterschätzenden Faktor für eine anregende Session: Dauer. An die richtig saftigen Momente und Zustände des Flows kommt man wohl erst ran, wenn man sich Zeit nimmt und die Zeit für sich arbeiten lässt. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer Plansequenz im Film, die aus einer einzigen, langen Einstellung besteht und in der sich erst in dieser Dauer ein besonderes Seherlebnis ereignet: das Bild erhält gewissermaßen Volumen, der•die Rezipient•in kann in das Bild eintauchen und in ihre•seine Lust an der eigenen Wahrnehmungserfahrung, weil es nicht mehr darum geht, der Narration zu folgen und zu kombinieren, wer jetzt der Mörder ist… In Sessions erlebe ich als gebende Person diese Momente dann, wenn nach einiger Zeit wie bei einer Zwiebel nach und nach einige Schichten an Zivilisation abgetragen wurden, bis ich irgendwo im Ausdruck meines Gegenübers plötzlich einen hochempfindlichen und -empfänglichen ‚Kern‘ (wobei das gar nicht so essentialisierend gemeint sein will, weil mit dem ‚Kern‘ eher eine Offenheit gemeint ist) erblicke, in dem ganz viel von dem drin steckt, was immer auch was mit Sterblichkeit und Gebürtlichkeit zu tun hat und was ich nur ganz unbeholfen umschreiben kann. Einen solchen vulnerablen und doch starken Ausdruck betrachten zu dürfen, ist vergleichbar mit einem Gefühl, das mal während einer Israelreise nach langer Wanderung durch die Wüste Negev mein Gemüt bewegte, als ich plötzlich bei einem großen Krater ankam und dann überwältigt, demütig und ehrfürchtig, mit einem Gefühl leichten, genussvollen Erschauerns oder ‚delightful horrors‘ einfach in den Krater schaute und das aushalten musste, dass da jetzt dieser Krater ist, in seiner ganzen unverwertbaren und das Denken übersteigernden Anwesenheit.
In Interaktion mit einem Menschen während einer Session kommt das Gefühl krasser Verantwortung und hochsensibler Intimität hinzu, das sich aus dem Vertrauen speist, das alle Beteiligten in die Situation gebracht haben müssen, wenn es einmal so weit gekommen ist, dass sich ein solcher Moment des Erhabenen ergibt.
Seit dem Sitzkreissharing gehe ich nochmal anders in Sessions rein. Weil alles verdichteter wird, wenn ich mir ins Bewusstsein rufe, dass es neben der puren Freude an der Kreativität und des Erfindungsreichtums, die Sessions erfordern, und ihren Momenten des Spaßes an alternativen Kommunikationsformen, vor allem solche diskreten Einblicke und sublimen Möglichkeitsräume des Staunens sind, die überhaupt erst den entscheidenden Reiz ausmachen, mit anderen zu spielen. Vor allem aber sind die in den Workshops erlernten Praktiken nicht Selbstzweck oder der Selbstoptimierung dienlich, sondern Mittel des Erkenntnisinteresses und der Begegnung mit dem Anderen im emphatischen Sinne.